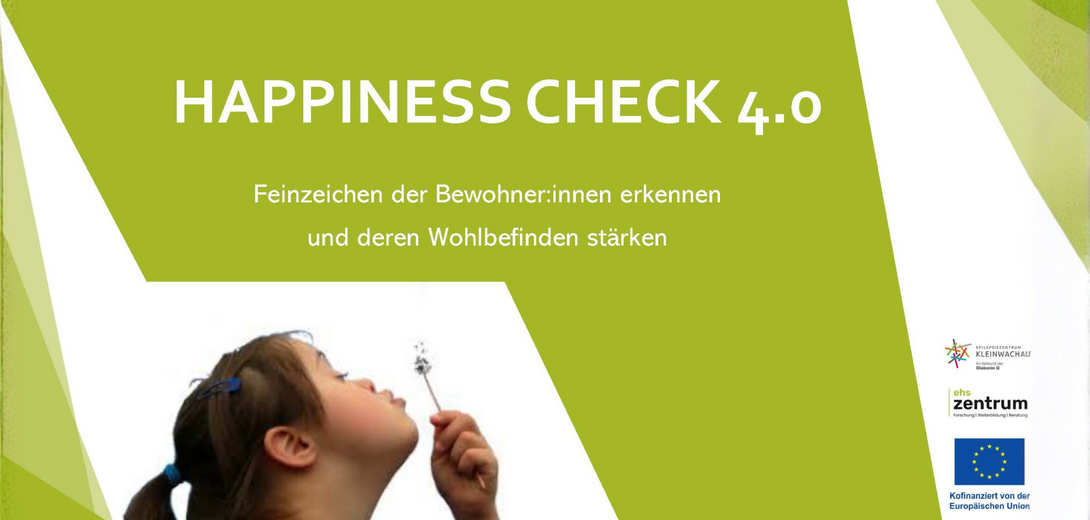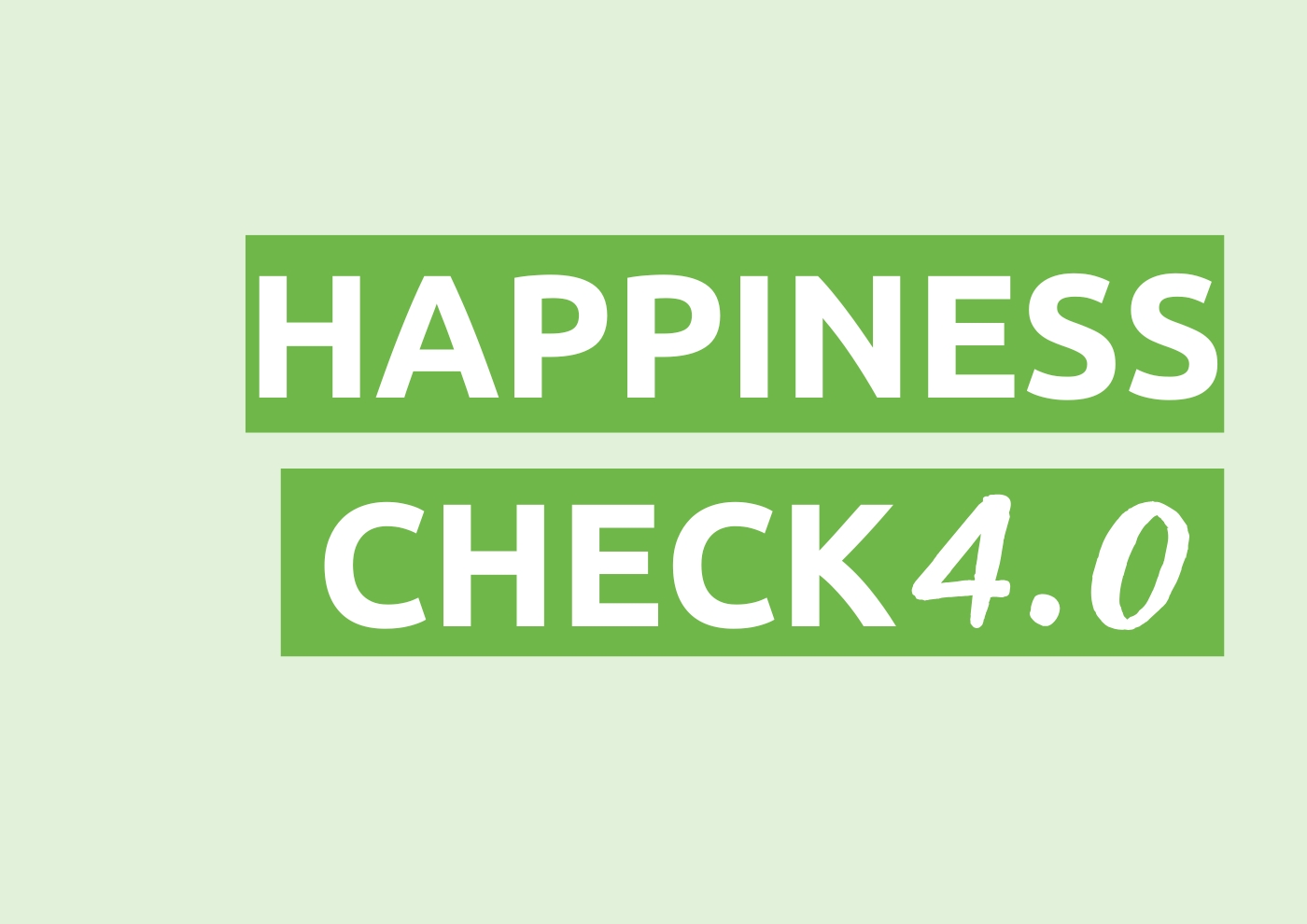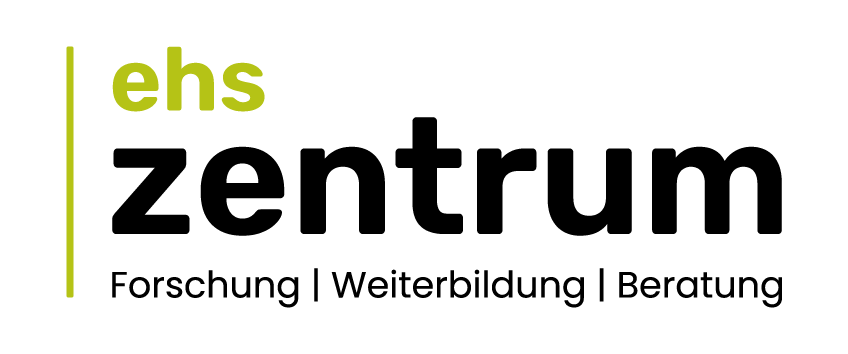Innovation und Inklusion
Was ist Happiness Check 4.0?
Happiness Check 4.0 ist ein innovativer Ansatz zur Kommunikation ohne Worte. Und es geht um die Frage: Wie lässt sich Zufriedenheit messen – bei Menschen, die sich selbst nicht äußern können?
Im Projekt Happiness Check 4.0, gefördert vom Sächsischen Sozialministerium und dem Europäischen Sozialfonds, entwickeln wir im Epilepsiezentrum Kleinwachau gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule Dresden ein innovatives System zur Erfassung der Lebensqualität von Menschen mit starken kognitiven oder motorischen Beeinträchtigungen.
Unter starken kognitiven Beeinträchtigungen versteht man erhebliche Einschränkungen in Denken, Sprache und Verständnis, die selbst einfache Entscheidungen oder Alltagsaktivitäten erschweren.
Motorische Beeinträchtigungen wiederum betreffen die Bewegungsfähigkeit – etwa wenn Lähmungen, Spastiken oder fehlende Muskelkontrolle eigenständige Handlungen unmöglich machen. In beiden Fällen können sich die Betroffenen nicht oder nur sehr eingeschränkt sprachlich äußern.
Genau hier setzt Happiness Check 4.0 an: Es entwickelt Wege, wie Zufriedenheit und Bedürfnisse auch ohne Worte erkennbar und verstehbar werden. Für ein Mehr an Lebensfreude, Lebensqualität, Teihabe und Selbstbestimmung.
Analyse und Austausch
Das sind die Ziele von Happiness Check 4.0
Wie können wir die Welt von Menschen erfassen, die nicht sprechen können – deren Bedürfnisse aber dennoch gehört werden wollen? Dort setzt das Projekt Happiness Check 4.0 an.
Im Mittelpunkt stehen Bewohner:innen mit sehr starken kognitiven und/oder motorischen Beeinträchtigungen, die nicht an herkömmlichen Befragungen teilnehmen können. Ziel ist es, ihre Zufriedenheit und Bedürfnisse über körperliche Signale, Mimik und Gestik wahrzunehmen und zu verstehen.
Das Projekt entwickelt ein innovatives Verfahren zur Erfassung von Zufriedenheit – auf Basis eines Videoanalyseansatzes, der bereits im „Dresdner Modell“ für Kitas erfolgreich erprobt wurde. Kurze Alltagsszenen werden aufgezeichnet, feinste Ausdrucksformen analysiert und gemeinsam im Team interpretiert. So entsteht ein tieferes Verständnis dafür, was Menschen mit Behinderungen stärkt, beruhigt oder belastet.
Happiness Check 4.0 verfolgt das Ziel, die Qualität der Wohnangebote zu sichern und weiterzuentwickeln. Die Erkenntnisse aus der Videoanalyse regen Veränderungsprozesse auf mehreren Ebenen an:
- Fachlich: Sie fördern Haltung, Wahrnehmung und professionelles Handeln der Mitarbeitenden.
- Strukturell: Sie geben Impulse für Abläufe, Raumgestaltung und Alltagspraxis.
Nach der Pilotanwendung soll das entwickelte Verfahren auch anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung gestellt werden.
Praxis und Pädagogik
So funktioniert Happiness Check 4.0
Happiness Check 4.0 verbindet wissenschaftliche Methoden mit praktischer Erfahrung. Das Projekt setzt auf Praxisforschung und vereint das Wissen von Menschen mit Behinderungen, ihren Angehörigen sowie Fach- und Betreuungskräften aus Pädagogik und Medizin.
Gemeinsam wird eine innovative Lösung entwickelt, um die Zufriedenheit von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen sichtbar zu machen.
Die methodische Basis bildet das am Zentrum für Forschung, Weiterbildung und Beratung an der ehs Dresden gGmbH entwickelte Dresdner Modell.
Was ist das Dresdner Modell? Das Dresdner Modell ist ein Qualitätsentwicklungsverfahren, das ursprünglich für Kindertageseinrichtungen (insbesondere Krippen) entwickelt wurde und das Wohlbefinden der Kinder über nonverbale „Feinzeichen“ in den Mittelpunkt pädagogischen Handelns stellt.
Es arbeitet mit videogestützten Beobachtungen und moderiertem Austausch im Team, um anhand feinster Signale, Interaktionen und situativer Befindlichkeiten Verbesserungen im pädagogischen Alltag anzustoßen.
Dieses Konzept nimmt nonverbale Signale – etwa Mimik, Gestik oder Körperbewegungen – wahr, beschreibt und deutet sie im Kontext des Befindens einer Person. Forschungsergebnisse zeigen, dass dieses Konzept kontext-, kultur- und altersübergreifend anwendbar ist.
Für Happiness Check 4.0 wird das Dresdner Modell praxisorientiert weiterentwickelt und auf den Kontext von Wohnangeboten für erwachsene Menschen mit Behinderungen übertragen.
Dabei entsteht ein Verfahren, das feinste Ausdrucksformen systematisch erfasst und in Teams reflektiert werden kann – ein neuer Weg, um Lebensqualität und gute oder mangelnde Zufriedenheit auch ohne Worte zu verstehen.
Das Projekt entsteht in enger Kooperation zwischen dem Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH und dem Zentrum für Forschung, Weiterbildung und Beratung an der ehs Dresden gGmbH. Kleinwachau übernimmt die Projektleitung, die operative Entwicklung und die Umsetzung in der Praxis.
Unsere Partner:innen von der ehs Dresden verantworten die wissenschaftliche Begleitung, die methodische Ausgestaltung und die Evaluation der Pilotanwendung. Hieraus soll eine eine enge Verbindung von Forschung und Alltagserfahrung ermöglicht werden.
Kommunikation und Kontext
„ Es ist erstaunlich, wie individuell und umfangreich die nonverbale Kommunikation sein kann. Wir wissen, dass man nicht nicht kommunizieren kann und die Fülle an Feinzeichen, die uns die Bewohner:innen senden, kann man mit dem bloßen Auge kaum im vollen Maß erfassen. Mit der Videografie haben wir die Möglichkeit kleinste Feinzeichen in einzelnen Sequenzen des Alltags der Bewohner:innen zu erfassen, gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen zu reflektieren und diskutieren und somit die Kommunikation und Qualität im Betreuungsalltag zu steigern. “